Ja, und wenn Sie in den vergangenen Tagen und Wochen die legendäre Wende-Pressekonferenz mit Günter Schabowski noch nicht oft genug gesehen haben: Beim Deutschen Rundfunkarchiv können Sie sich die entscheidende Passage ansehen, immer wieder.
Schlagwort: Wende
Beflaggung
Na, das ist doch mal ne Suchanfrage – und der erste Treffer führt bei google gleich hierher zu kohlhof.de: “Wie muss ich heute beflaggen” wollte jemand wissen – ein Antwort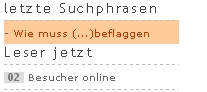 darauf gibt es hier zwar nicht, aber auch so kann deutlich werden, dass heute ein besonderer Tag ist. Allerdings dürfte klar sein, dass Privatleute heutzutage nicht mehr verpflichtet sind, an gewissen Jahrestagen Flaggen aufzuziehen. Diese Idee fand mit dem Ende der DDR ihr Ende – auch wenn an manchen Haustüren und Fensterrahmen noch die Halterungen für Fahnen und Flaggen zu erkennen sind. Und wenn man das unbedingt möchte: “wie” man eine Flagge aufhängt, und vor allem, welche, ist doch eigentlich klar, oder? Schwarz oben, Gold unten – und bitte die Flagge ohne Adventskranz in der Mitte nehmen…
darauf gibt es hier zwar nicht, aber auch so kann deutlich werden, dass heute ein besonderer Tag ist. Allerdings dürfte klar sein, dass Privatleute heutzutage nicht mehr verpflichtet sind, an gewissen Jahrestagen Flaggen aufzuziehen. Diese Idee fand mit dem Ende der DDR ihr Ende – auch wenn an manchen Haustüren und Fensterrahmen noch die Halterungen für Fahnen und Flaggen zu erkennen sind. Und wenn man das unbedingt möchte: “wie” man eine Flagge aufhängt, und vor allem, welche, ist doch eigentlich klar, oder? Schwarz oben, Gold unten – und bitte die Flagge ohne Adventskranz in der Mitte nehmen…
Tag der Geschichten
Der 20. Jahrestag des Mauerfalls ist der Tag der Geschichte – und der Geschichten, von denen jeder seine ganz eigene erzählen kann. Hier sind einige meiner Erinnerungen an den Tag des Mauerfalls 1989 und an die Wochen danach. Zum Beispiel die kurze Geschichte von den drei Spaziergängern aus dem Osten, die am Gustav-Radbruch-Platz in Lübeck auf dem Radweg schlenderten in jener Novembernacht 1989. Und als ich da angeradelt kam und klingelte, sprangen diese drei Menschen zur Seite und die Frau rief mir entschuldigend hinterher: “Hach, wir müssen noch so viel lernen.” Ein bemerkenswerter Satz, der wohl nur gesagt wurde, weil in der Freude über das Unfassbare auch noch ein bisschen Verunsicherung mitschwang. Das war jedenfalls meine erste Begegnung mit Ossis auf Westbesuch.
Oder die Geschichte von der kurzen Brieffreundschaft mit Annette aus Wismar-Dargetzow: Der Kontakt ist nach ein paar Briefwechseln wieder eingeschlafen. Annette war mit ihrem Freund ein paar Tage nach der Grenzöffnung ins Katharineum gekommen, wo Schüler, Eltern und Lehrer an einigen Sonnabenden einen Basar mit gespendetem Spielzeug, Kleidung sowie Kaffee und Kuchen auf die Beine gestellt hatten. Sie haben sogar mal bei uns in der Hansestraße übernachtet, wenn mich nicht alles täuscht.
Dann gibt es auch noch die Geschichte von der jungen Familie aus Mecklenburg, die in der Lübecker Innenstadt Brigitte und Werner trafen. Deren Sohn war ein paar Monate zuvor gestorben – jetzt, mit der Zufallsbekanntschaft irgendwo im Trubel zwischen St. Jakobi und Dom, hatten die trauernden Eltern eine gute Möglichkeit gefunden, mit dem gesamten Spielzeug, das bis dahin immer noch im Kinderzimmer stand, anderen noch eine Freude machen zu können.
Und dann war da das kleine Mädchen im Vorgarten einer Mietskaserne zwischen Herrnburg und Utecht – auf jeden Fall im Sperrgebiet, also dort, wo bis zum 9. November 1989 niemand einfach so mal Gäste haben durfte, weil die fünf Kilometer vor der eigentlichen Grenze zum Westen ein isloierter Bereich waren. Und dieses Mädchen hat uns eingeladen, als wir bei einer Radtour durchs Dorf fuhren: “Mutti, wir haben Besuch!” Wir haben also bei vollkommen Unbekannten im Wohnzimmer gesessen – und haben als Erinnerung zwei Packungen Würfelzucker bekommen. Die Zuckerstücke waren teilweise hellblau und hellrosa und hatten die Formen von Spielkartensysmbolen.
Und, welche ganz besonderen Erinnerungen haben Sie an die Wende?
Zettel-Wirtschaft
Die bislang beste und interessanteste Dokumentation über den Tag der Wende vor fast 20 Jahren gabs am Montag im Ersten zu sehen. “Schabowskis Zettel”: Im Mittelpunkt eben die kleine Notiz, die Günter Schabowski am 9. November 1989 um kurz vor 19 Uhr vor der internationalen Presse in Ost-Berlin vorgetragen hat, obwohl diese Mitteilung eigentlich eine Sperrfrist bis zum nächsten Morgen trug. So aber geriet der Zettel außer Kontrolle.
Da kamen Zeitzeugen zu Wort, die sehr mitreißend erzählt haben. Vier Bilder waren teilweise nebeneinander geschnitten, um zu verdeutlichen, was alles gleichzeitig in Berlin passiert ist an jenem Abend. Wie eine Sonderausgabe der Fernsehserie “24”. Den Zettel übrigens kann man sich noch mal ansehen, er ist auf der Homepage des NDR als PDF-Datei zu finden. Beachten Sie auch die zweistellige Archiv-Nummer des Bundesbauftragten für die Stasi-Unterlagen.
Und den Film selbst gibt es (noch) in der Mediathek der ARD zu sehen.
via.
Wie sagt man?
Notruf aus Lettland: “Christian, unser Unternehmen will der deutschen Botschaft einen Brief zum 3. Oktober schicken. Wie sagt man: Herzlichen Glückwunsch zum Tag der Deutschen Einheit? Oder Herzliche Grüße?” – Tja, das diplomatische Parkett ist ein äußerst glattes, da will man ja ungern was Falsches sagen. Nach längerem Überlegen kam ich zum dem Schluss, dass “Herzliche Glückwünsche” durchaus passend klingt. Wie sind hier die Meinungen?
Zeitrechnung
Das zwanzigste Jahr nach der Wende ist mein zehntes Jahr im Osten des wiedervereinigten Deutschlands. Ich kann wirklich sagen, dass ich als gelernter Wessi seit langer Zeit hier gut zurechtkomme, man hat mich wohlwollend aufgenommen und man bekommt von hier aus einen interessanten, hilfreichen Blickwinkel auf den Alltag und den Rest der Republik – es gibt da allerdings etwas, an das ich mich nicht gewöhnen kann. Es geht um Uhrzeiten. Die Tatsache, dass es 13:15 Uhr ist, nehme ich klaglos hin, dass man hierzulande allerdings “viertel Zwei” sagt, wenn man “Viertel nach Eins” meint, macht mich fertig. Denn “Viertel Zwei” ist ja nicht “Viertel vor Zwei”, letzteres ist nach ostdeutscher Logik vielmehr “Dreiviertel Zwei”. Ganz im Ernst: Hier gehen die Uhren anders.
Man hat schon mehrfach versucht, mir das auf liebevolle, manchmal auch ungeduldige Weise zu erklären: So wie 13:30 Uhr eben halb Zwei ist, also 50 Prozent von zwei Uhr, ist 13:15 Uhr eben ein Viertel zwei – also 25 Prozent der zweiten Stunde am Nachmittag sind dann schon vergangen. Ich nehme diese Erläuterungen so hin und habe inzwischen auch verstanden, wie die Zeitrechnung hier funktioniert. Sogar in einigen südwestdeutschen Landstrichen wird das Uhrablesen nach dieser Methode praktiziert. Aber auch auf die Gefahr hin, hier im Nordosten als chronometrischer Legastheniker und gleichzeitig zeitloser Besserwessi zu gelten, fragte ich neulich, was denn mit 13:10 Uhr sei, also zehn nach Eins: “Ist das dann ein Sechstel Zwei?” Misstrauische Blicke. “Und 13:20 wäre dann… zwei Sechstel, nein, halt: ein Drittel Zwei. Stimmts?” Mitleidige Blicke gegenüber. “Und 13:48… das wäre demnach dann vier Fünftel Zwei, ja?”
Also, das sei ja nun ausgemachter Blödsinn. Wer sich denn so etwas Unpraktisches ausdenken würde… so etwas Seltsames habe man ja noch nie … also, da könne ja jeder … wer solle da denn noch … also weißte, also nee! Die Debatte brandete auf. Ich musste die Runde leider verlassen. Um Voll Zwei hatte ich bereits den nächsten Termin.
Ausreise
Es ist das meiner Meinung nach beeindruckendste Ton-Dokument der Zeitgeschichte: Hans-Dietrich Genscher auf dem Balkon der Prager Botschaft. Vom Balkon aus spricht der Bundesaußenminister zu tausenden Flüchtlingen aus der DDR. Die Nachricht: Sie dürfen ausreisen. Die zweite Hälfte seines Satzes geht im tosenden Jubel unter.
Heute habe ich dieses Zitat endlich mal in einem Beitrag verwenden können – wenn auch in vollkommen anderem Zusammmenhang. Mit den Kollegen Oliver Schubert und David Pilgrim habe ich ein fiktives Tagebuch von Hansa-Rostock produziert. Anlass war die Tatsache, dass die Mannschaft nach einem Testspiel im Iran wegen Schneewetters vier Tage in Teheran festsaß. Wir haben rumgesponnen, was den Abflug noch hätte verzögern können: Abgelaufene Pässe, Airline pleite und so weiter.
Nach fast einem Jahr Zwangspause im Iran dann: Hoher Besuch aus Deutschland. Und dann der O-Ton von Genscher, der nun zur Hansa-Mannschaft sagt: “Wir sind heute zu ihnen gekommen, um ihnen mitzuteilen, dass heute ihre Ausreise…..”
Uns hats Spaß gemacht, dieses kleine Hörspiel zu produzieren – ist hoffentlich gut angekommen.
Übbrigens habe ich Herrn Genscher mal bei einem Wahlkampftermin vor ein paar Jahrenn in Rostock getroffen. Ich habe ihn gefragt, wie der Satz eigentlich weiterging, den er da auf dem Balkon gesagt hat. Eher unspektakulär: “…in die Bundesrepublik Deutschland möglich geworden ist.”